Willkommen beim Qualifier
Beschleunigen Sie Ihre BIM Prozesse
und reduzieren Sie durch automatisierte Modelldatenprüfungen die Fehlerquote.
Ohne Kreditkarte, ohne Anmeldung – Unlimitiert testen*
Qualifier hilft in vielen Projekten, die Datenqualität von BIM Modellen zu verbessern
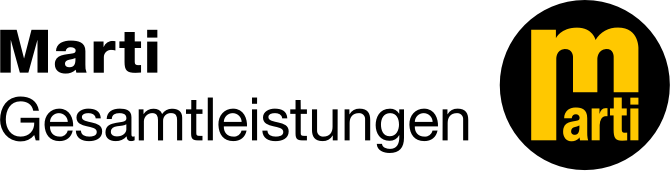


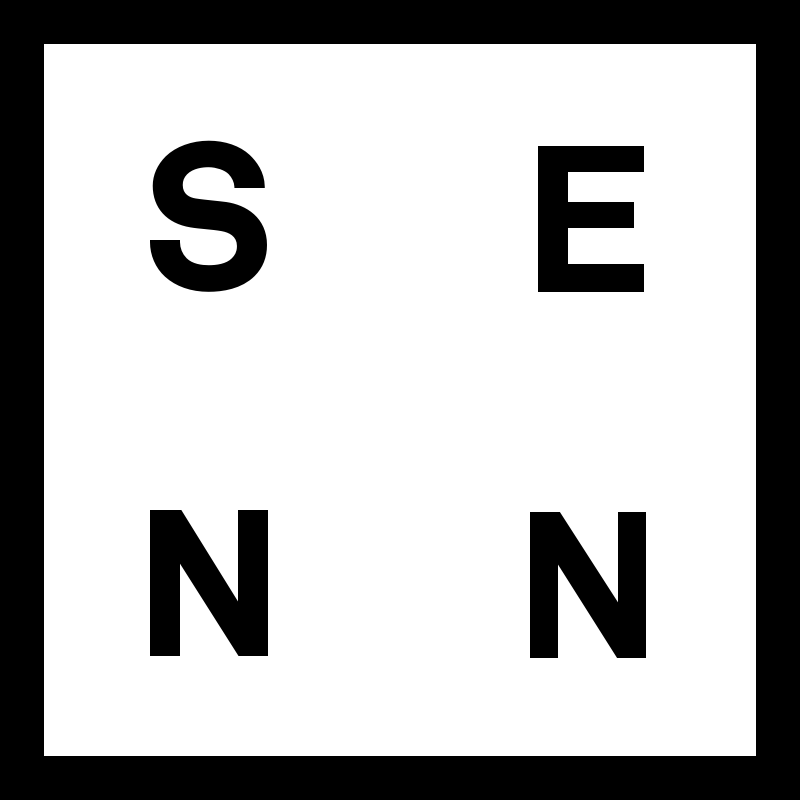
Qualitätssicherung für Ihre BIM Projekte
in 4 einfachen Schritten
Integrieren Sie Qualifier in Ihre BIM Arbeitsabläufe und beginnen Sie die Reise hin zu einer erfolgreichen Qualitätssicherung.
Definieren und verwalten Sie ihre individuellen Datenanforderungen und gewähren Sie modellierenden Projektmitarbeitern Zugang zum Qualifier.
Schritt 1
Ordnen Sie das Modell
Filter ermöglichen es, das Modell in Gruppen gleichartiger Bauelementen zu unterteilen.
Schritt 2
Erforderliche Daten definieren
Organisieren Sie die erforderlichen Eigenschaften in Tabellen, die einfach durchsucht und exportiert werden können.
Schritt 3
Erstellen Sie Regeln
Regeln stellen sicher, dass jede Eigenschaft vorhanden ist und Daten im erwarteten Format enthält.
Schritt 4
Validieren
In der Prüfungsansicht sind Sie nur einen Klick von einer Zusammenfassung der Datenqualität Ihres Modells entfernt.
Welcher Tarif
ist für Sie geeignet?
KOSTENLOS
Ein/e Benutzer/in
und eine Validierungskonfiguration
CLOUD
Unlimitierte Konfigurationen und Projektmitarbeiter